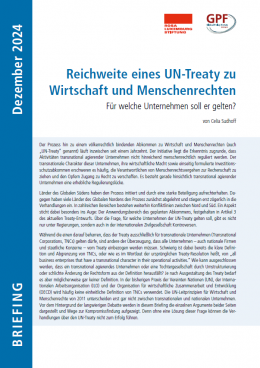Der Prozess hin zu einem völkerrechtlich bindenden Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten (auch „UN-Treaty“ genannt) läuft inzwischen seit einem Jahrzehnt. Der Initiative liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Aktivitäten transnational agierender Unternehmen nicht hinreichend menschenrechtlich reguliert werden. Der transnationale Charakter dieser Unternehmen, ihre wirtschaftliche Macht sowie einseitig formulierte Investitionsschutzabkommen erschweren es häufig, die Verantwortlichen von Menschenrechtsvergehen zur Rechenschaft zu ziehen und den Opfern Zugang zu Recht zu verschaffen. Es besteht gerade hinsichtlich transnational agierender Unternehmen eine erhebliche Regulierungslücke.
Länder des Globalen Südens haben den Prozess initiiert und durch eine starke Beteiligung aufrechterhalten. Dagegen haben viele Länder des Globalen Nordens den Prozess zunächst abgelehnt und stiegen erst zögerlich in die Verhandlungen ein. In zahlreichen Bereichen bestehen weiterhin Konfliktlinien zwischen Nord und Süd. Ein Aspekt sticht dabei besonders ins Auge: Der Anwendungsbereich des geplanten Abkommens, festgehalten in Artikel 3 des aktuellen Treaty-Entwurfs. Über die Frage, für welche Unternehmen der UN-Treaty gelten soll, gibt es nicht nur unter Regierungen, sondern auch in der internationalen Zivilgesellschaft Kontroversen.
Während die einen darauf beharren, dass der Treaty ausschließlich für transnationale Unternehmen (Transnational Corporations, TNCs) gelten dürfe, sind andere der Überzeugung, dass alle Unternehmen – auch nationale Firmen und staatliche Konzerne – vom Treaty einbezogen werden müssen. Schwierig ist dabei bereits die klare Definition und Abgrenzung von TNCs, oder wie es im Wortlaut der ursprünglichen Treaty-Resolution heißt, von „all business enterprises that have a transnational character in their operational activities.“ Wie kann ausgeschlossen werden, dass ein transnational agierendes Unternehmen oder eine Tochtergesellschaft durch Umstrukturierung oder schlichte Änderung der Rechtsform aus der Definition herausfällt? Je nach Ausgestaltung des Treaty bedarf es aber möglicherweise gar keiner Definition. In der bisherigen Praxis der Vereinten Nationen (UN), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wird häufig keine einheitliche Definition von TNCs verwendet. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von 2011 unterscheiden erst gar nicht zwischen transnationalen und nationalen Unternehmen. Vor dem Hintergrund der langwierigen Debatte werden in diesem Briefing die einzelnen Argumente beider Seiten dargestellt und Wege zur Kompromissfindung aufgezeigt. Denn ohne eine Lösung dieser Frage können die Verhandlungen über den UN-Treaty nicht zum Erfolg führen.
Reichweite eines UN-Treaty zu Wirtschaft und Menschenrechten
Für welche Unternehmen soll er gelten?